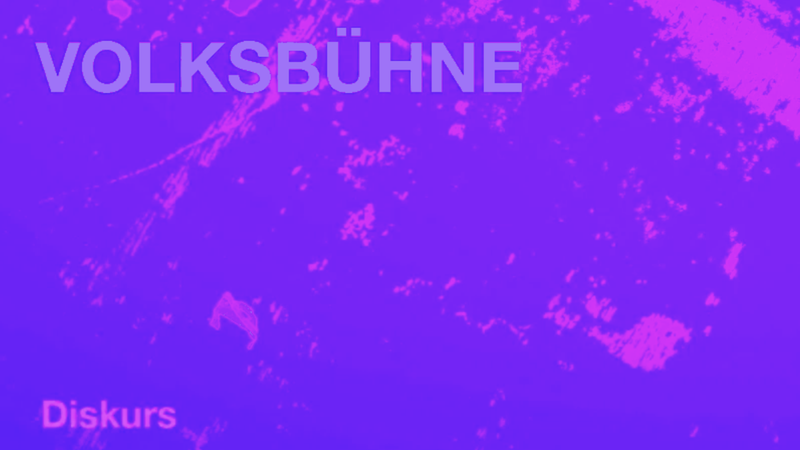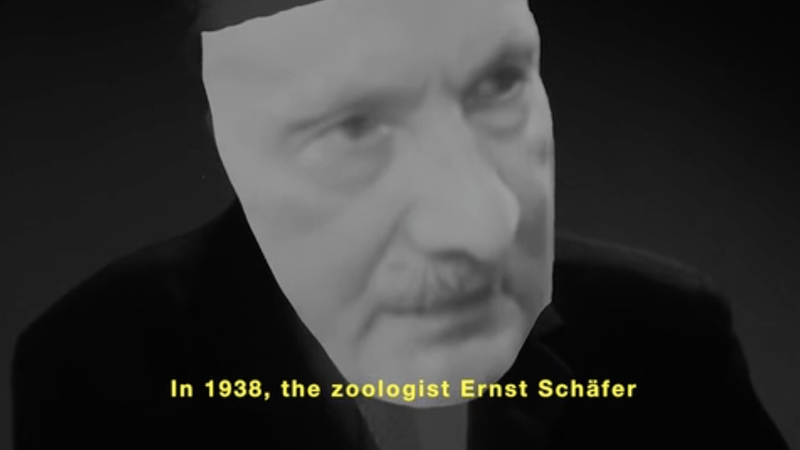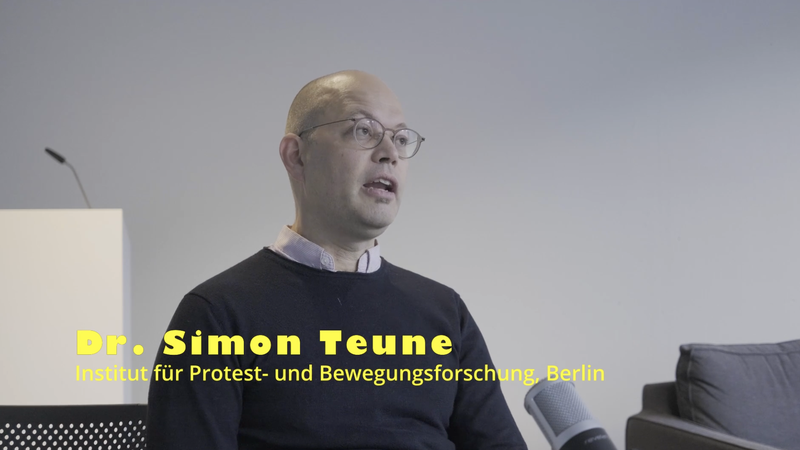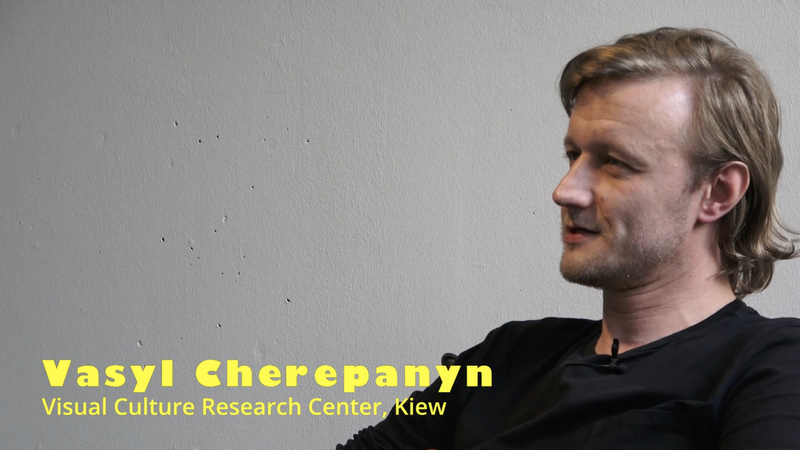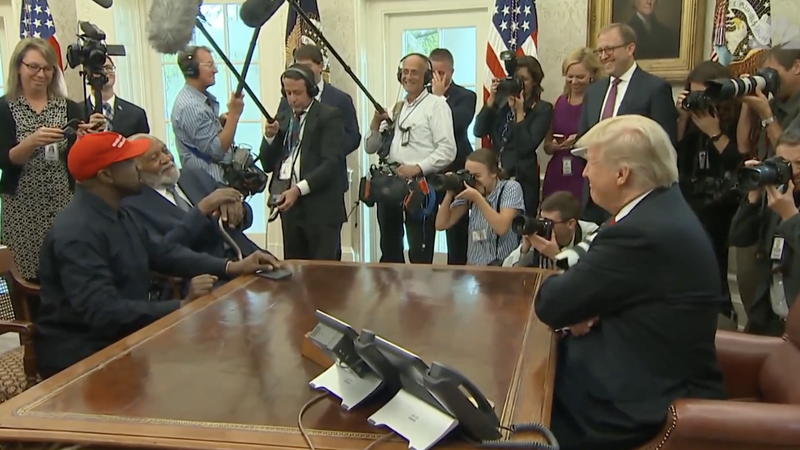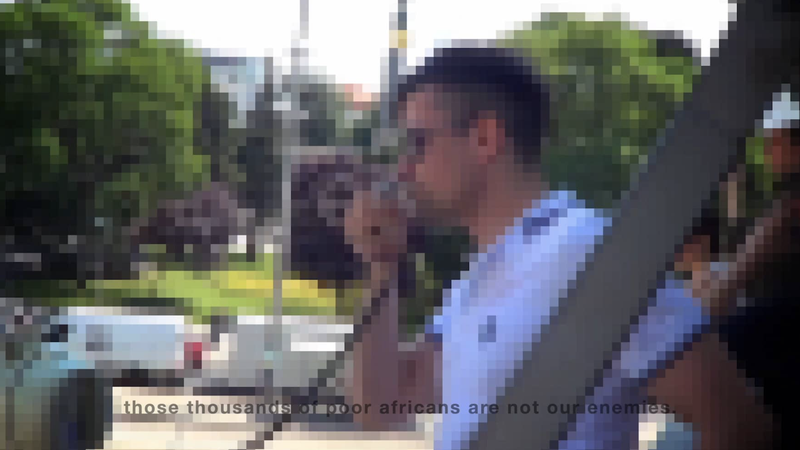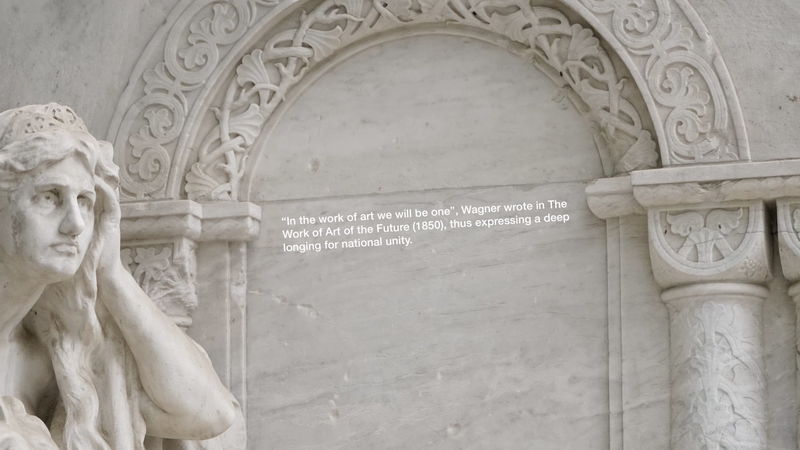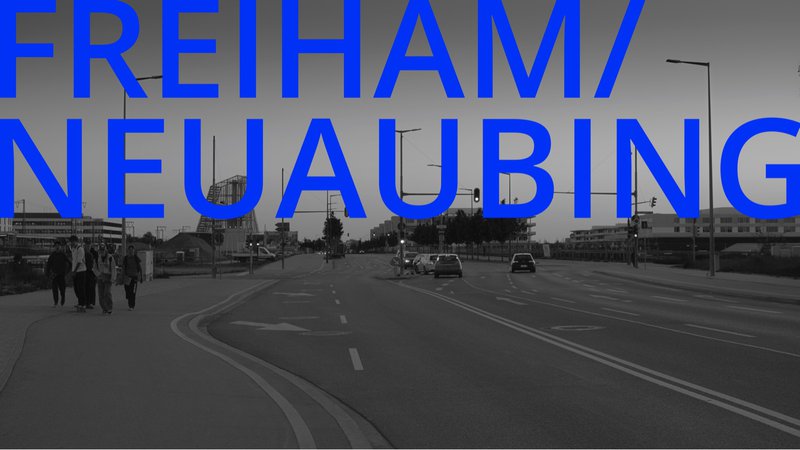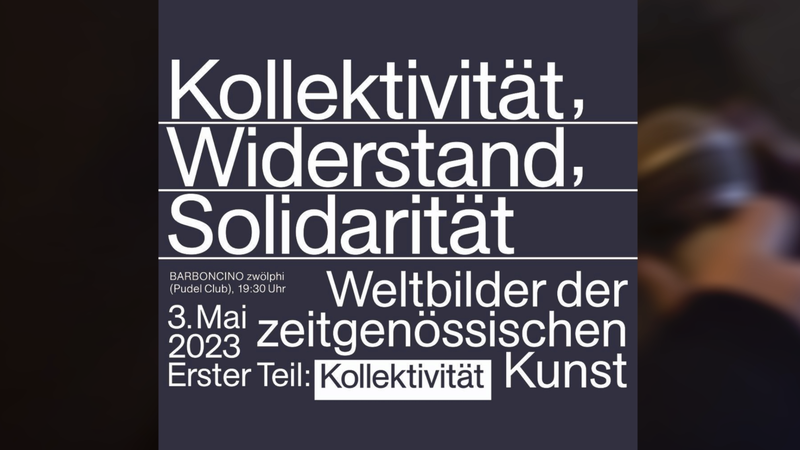
9:30
WELTBILDER DER KUNST– KOLLEKTIVITÄT
Zusammenschnitt der Veranstaltung im
BARBONCINO zwölphi, Hamburg 2023

1:00
TRAILER SOLIDARITÄT, APPEASEMENT, SPALTUNG
Kontinuitäten des Antisemitismus
05. Januar 2021 um 19:00, Volksbühne digital

8:34
GG5.3 WELTOFFENHEIT KURZ-SPEZIAL
Zusammenfassung Kontinuitäten des Antisemitismus
vom 29. März 2021 in der Volksbühne
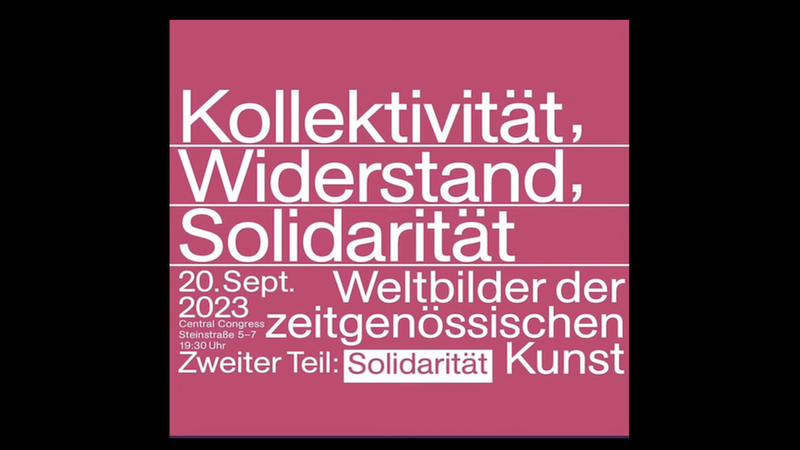
28:41
WELTBILDER DER KUNST – SOLIDARITÄT
"Die Documenta – wie antisemitisch war sie wirklich?"
Vortrag von Prof. Dr. Julia Bernstein

1:17:33
KONTINUITÄTEN DES ANTISEMITISMUS –
ZWISCHEN LÜGEN, ABWEHR UND KONKURRENZ
Volksbühne Berlin, Oktober 2020
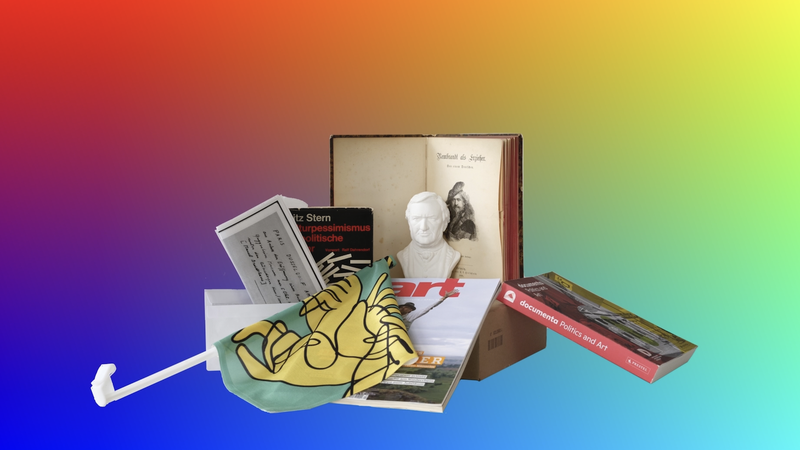
21:09
DER ERLÖSUNGSKOMPLEX
Film für die Tagung "Von der Kunstfreiheit gedeckt?" im Haus der Wannseekonferenz, Mai 2023

0:36
TRAILER WELTOFFENHEIT SPEZIAL
Kontinuitäten des Antisemitismus
29. März 2021 um 19:00, Volksbühne digital

11:34
ERINNERUNGSKULTUR UND SCHULDABWEHR
Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten
Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020
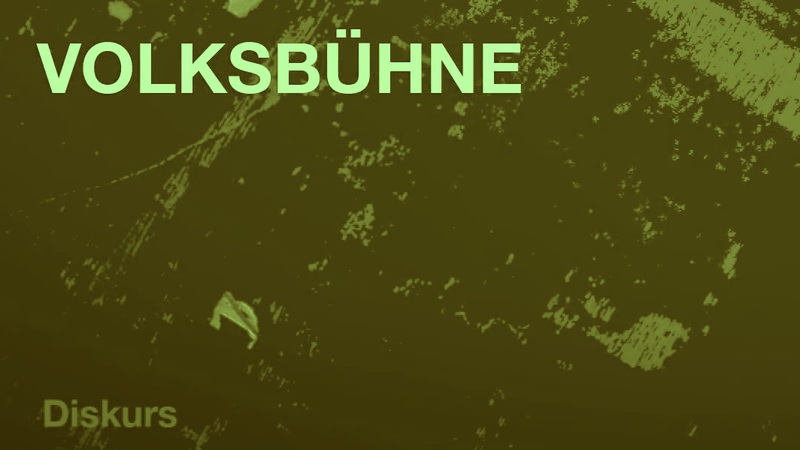
58:08
KONTINUITÄTEN DES ANTISEMITISMUS –
SOLIDARITÄT, APPEASEMENT UND SPALTUNG
Volksbühne Berlin, Januar 2021

27:15
WELTBILDER DER KUNST – WIDERSTAND
Gespräch mit Kateryna Mishchenko,
Essayistin, Verlegerin und Übersetzerin

28:09
FRIEDEN IN ANFÜHRUNGSZEICHEN
Gespräch mit der Sozialwissenschaftlerin
Ferda Berse über ideologisierte Begriffe

13:49
DAS PALMENHAUS IST ABGEBRANNT
Produktion für die Ausstellung "Walhalla to Birkenau" in der Kunsthalle Osnabrück, 2022

11:50
KULTURPESSIMISMUS ALS QUERFRONT
Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten
Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020

11:50
PROJEKTIONEN AUF DEN OSTEN
Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten
Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020

13:53
TRADITIONSLINIEN DER DEUTSCHEN KUNST
Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten
Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020

3:38
DEATH THREATS SENT FROM GERMAN POLICE SERVERS
Forum Infoclip 9/14
für Kunstsammlung NRW, K21, 2020

11:46
BIRKENAU
Produktion für die Ausstellung "Walhalla to Birkenau" in der Kunsthalle Osnabrück, 2022